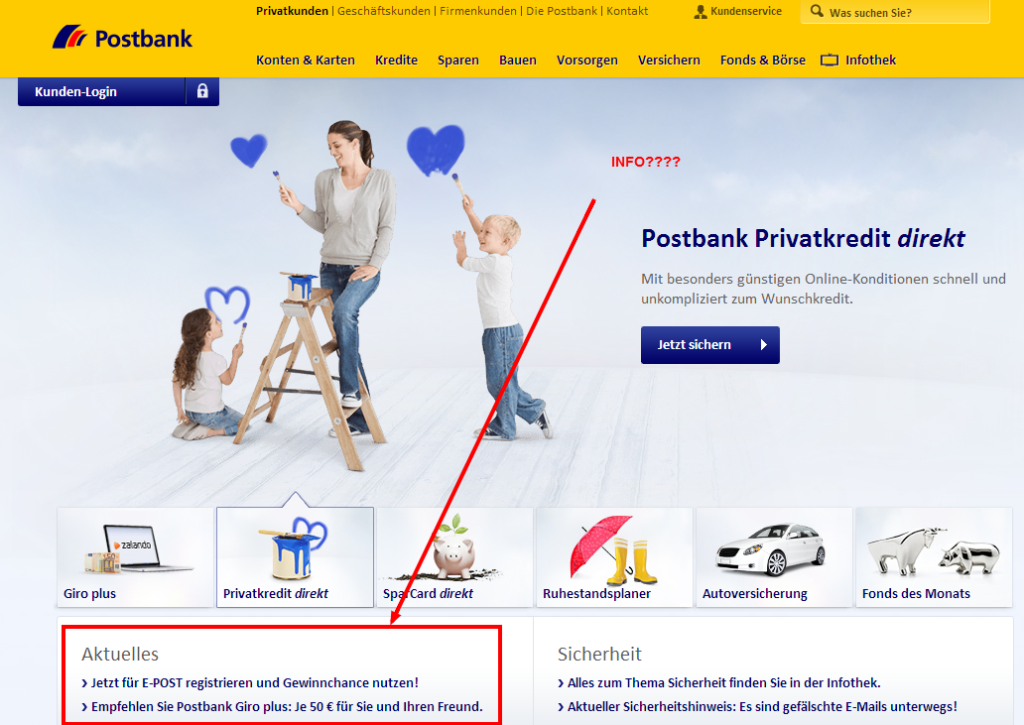Fußball war mir früher egal. Bespaßung für die Massen war das für mich. Brot und Spiele für die Bevölkerung, die unterhalten werden muss. Bestenfalls ein Event, das die Menge vereint, aber ohne weiteres Begeisterungsgefühl. “Interessierst Du Dich für Fußball?”, frug mich der Kollege damals in der Ausbildung. “Nein”, antwortete ich wahrheitsgemäß, woraufhin sich der Kollege desinteressiert abwendete. Allerdings war der als Maintaler auch Bayern München Fan und daher sowieso irgendwie suspekt. Nein, also dieser Fußball mit seinen ulkigen Fans und dem ganzen Zauber drumherum – es interessierte mich nicht sonderlich.
Heute sehe ich das etwas differenzierter.
“In der Saison 93/94 war ich bei jedem Heimspiel dabei”, schrieb mir mein Kumpel Kang-Ping letztens aus Taiwan. “Über den Sohn vom Trainer sind wir damals günstig an Karten gekommen, 5 DM das Stück. Ich habe da jedes Spiel mitgenommen.” Das hätte ich seinerzeit auch mal machen müssen. Einfach mal rechtzeitig ins Stadion gehen und diesen Fußball erleben, der mir so jahrelang egal war. Wahrscheinlich lag es daran, dass wir damals im Ausland gelebt haben oder mein Vater ebenso wenig Interesse für diesen oder überhaupt einen Sport aufzeigen konnte. Ich bin sehr nach ihm geraten, wir interessierten uns für die Kunst, weniger für Leibesertüchtigungen. Dabei ist Fußball sogar ein großartiges Mittel zur Völkerverständigung und der ultimate ice breaker für jede Konversation. Allein – das Interesse fehlte.
Wenn man Fußball nur aus dem Fernsehen kennt, kann auch keine richtige Freude aufkommen. Man muss da schon ins Stadion gehen und diesen Vibe spüren. Ich musste erst 38 Jahre alt werden, um auf Twitter diesen Wunsch zu einem Stadionbesuch zu äußern, der mir einen ganz wunderbaren Besuch bei der Partie Werder Bremen vs. Eintracht Frankfurt bescherte. Nochmals vielen Dank an @penn_y_lane, die schon als Kind zur Eintracht mitgenommen wurde. Überhaupt, die Eintracht. Die Sportgemeinde Eintracht Frankfurt von 1899 e.V..
Über meine Zufriedenheit mit Frankfurt schrieb ich ja bereits. Frankfurt ist mit seinem hohen Ausländeranteil ein willkommener Ort für alle diejenigen, deren Heimatverständnis mehr ein Erleben der Gegenwart ist, als die bedingungslose, hereditäre Treue zu einem Ort (so gesehen wäre ich vielleicht sogar gebürtiger geborener Hamburger, aber der HSV?! Lotto King Karl, ok, aber der Rest? Dann schon viel eher Werder Bremen.). Bei einer Stadt wie Frankfurt also ist es nur folgerichtig, dass die Eintracht Frankfurt aus meiner Sicht so ein schönes Sammelbecken für Frankfurter ist. Beim Spiel gestern saß ein Haufen Japaner neben uns. Für mich ist das ein ganz wunderbarer Grund, ins Stadion zu gehen.

“Die Eintracht, da ist jeder willkommen!”. So oder so ähnlich erzählten es mir Bekannte bereits im Vorfeld, und das sagen die Fans wahrscheinlich bei jedem Verein. Ausgehend von der bunten Mischung an Fans kann ich dem auch nur zustimmen, wobei mich ein Besuch im sehr einheitlichen Fanblock jetzt auch sehr reizen würde. Womit ich zu meinen Likes und Dislikes komme:
Was ich mag:
Den Mannschaftssport. Keine Einzelkämpferleistung, sondern ein Miteinander und schöne Pässe. Spieler, die als Team auftreten und dynamisch die Lücken füllen, ohne vom Trainer dazu verdonnert zu werden. Das Fair Play, also die professionelle Haltung beim Spiel, die dieses Miteinander über den Kampf stellt. Das ist mir wichtiger als ein siegreiches Spiel. Tore finde ich nett, sehe sie aber eher als Garant für interessante Sponsoren.
Die Atmosphäre im Stadion. Du sitzt oder stehst auf der Tribüne und siehst da unten so kleine Figuren herumlaufen, hast einen besseren Überblick als die Spieler und denkst Dir die ganze Zeit: “Los jetzt!” oder “Raaaaaaan!!” oder “gib doch mal ab!” oder so Zeugs. Klugscheißergalore, wenn mir selber nach 100m die Puste ausgehen würde, aber trotzdem ist das geil. Sehr geil sogar. Sport live erleben, und das habe ich jetzt endlich gelernt, ist nochmal eine andere Liga als es immer nur passiv über einen Filter (i.e. TV) zu konsumieren. Wahrscheinlich wäre ein Partie Tennis live auch erträglicher.
Die Sprache. Einmal bei 11 Freunde vorbeischauen, alles querlesen und sich ob des Geschwafels erfreuen, das aber trotzdem vieles ganz genau beschreibt. Typen, die im Fernsehen stundenlang über den Sport reden. Früher war mir das sehr suspekt. Wie können die das nur ewig bequatschen? Haben die da selber mitgespielt oder auch nur (so wie ich) im Stadion mitbekommen? Überhaupt, ständig wird über irgendwelche Spielertransfers gesprochen und Siege hier und Führung dort. Über die Pässe und das Miteinander wird da gefühlt weniger gesprochen. Ist das wahr?
Die Erholung. Wie im Auge eines Tornados, so empfinde ich die 90 Minuten + Halbzeit im Stadion. Die pure Erholung. Natürlich fiebert man beim Spiel mit, aber ansonsten bin ich die Ruhe in Person während des Spiels. Volle Konzentration, aber ohne angestrengt zu sein. Wenn mich jetzt jemand fragt, ob ich mit zum Spiel kommen möchte, sehe ich da in erster Linie die geistige Erholung. Für mich ist das wie Meditation. Sehr, sehr erholsam. Sehr.
Die Strategie. Ein Land, das sich aktiv um eigene Nachwuchsspieler kümmert und aktiv aufbaut. Das mit einer U19-Mannschaft Erfolge einfährt und lieber selber etwas fördert als sich Potential aus dem Ausland einzukaufen.

Was ich nicht so mag:
Die Preise. Beim letzten Spiel wurde ich eingeladen (thx!), denn auf Dauer könnte ich mir den Spaß nicht leisten. Diese ganze Kommerzialisierung von den Fanutensilien (Trikotpreise!) über die Eintrittskarten bis hin zur Abzocke bei der Verpflegung ist total ätzend. Natürlich ist es logistisch eine große Erleichterung, wenn alle nur noch mit Prepaidkarten bargeldlos bezahlen und bei jedem großen Spiel die Fans kontrolliert hin- und weggeleitet werden, aber irgendwie kommt man sich da auch wie dummes Vieh vor, das möglichst nur konsumieren und gute Stimmung machen soll. Wirklicher Freiraum sieht da doch anders aus.
Manche Fans erfüllen wirklich alle Klischees hinsichtlich des typischen Hessen. Also FFH-Radiohörer, Onkelz-Fan (“Gehasst, vedammt, vergöttert” – fand ich als 18jähriger in Kenia auch mal gut) und allgemein Anhänger irgendwelcher Sprüche, die auch gerne als Wandtattoos oder als Lebensweisheiten auf der FB-Pinnwand verewigt werden. Wenn man diese Klischees bedient haben möchte, wird man hier fündig. Obwohl die Sprüche auf den Fanschals schon wieder witzig sind und Frankfurt dieses Image eigentlich noch viel weiter ausbauen müsste (“Hauptstadt des Verbrechens”). Überhaupt, Fußballfankultur ist eine Welt für sich und ich kann/darf es eigentlich gar nicht beurteilen. Als Neuling nimmt man dieses Bild aber oft als erstes wahr, und daher habe ich jetzt auch so lange gebraucht, um zum Fußball zu finden.
Was gar nicht geht: der Spruch “aus eigener Kraft” beim FSV. Welcher Kommunikationsberater hat sich diesen Mist ausgedacht? Aus wessen Kraft denn sonst? Aus fremder Kraft? WTF? Die haben eh schon so wenige Fans beim FSV, und dann so nen Vorstoß. Ich wohne direkt am FSV-Stadion und muss mir diesen Mist jetzt öfter anschauen. Oh man.
Die ständige Regulierung. Wahrscheinlich muss ich mal richtig in den Fanblock abtauchen und ein Spiel aus deren Sicht erleben, aber irgendwie kommt es mir so vor, dass man in Deutschland alles nur in geordneten Verhältnissen zelebrieren darf. Das scheint wohl auch ein Grund zu sein, wieso es dann bei den Fans zu solchen scheinbar starken Sprüchen kommt, die einerseits Dinge wie Stärke, Loyalität oder Leidensfähigkeit demonstrieren sollen, und andererseits aber nur das erlaubt wird, was der Sponsor abgesegnet hat. “Fanbanner bitte nur in der Halbzeit”, oder so. Hier würde ich gerne mehr von dem sehen, was die Fans wirklich fühlen. Nicht nur das was der Sponsor oder der Club als massentauglich empfindet. Dann kann man sich auch die vielen Sprüche sparen, die eher peinlich wirken weil so gekünzelt. Auf der anderen Seite lebe ich aber auch fernab der Helene-Fischer-Welt und kann keinen einzigen Schlager mitsingen, insofern habe ich da wohl auch einen anderen Anspruch. Aber dennoch: ich würde die Fans gerne mehr das rauslassen sehen, was sie fühlen. Und Vereine, denen diese Fankultur wichtiger ist als jetzt familientaugliches Wochenendentertainment.
——————————–
So egal wie früher ist mir Fußball jetzt also nicht mehr. Ich schaue genauer hin, wenn über Spiele berichtet wird und erfreue mich ob der puren Erholung während des Spiels. Es ist eine Welt für sich, allerdings mit geringer Einstiegshürde und globalem Interesse. Ich musste erst etwas älter werden, um diese Form der Unterhaltung für mich als gut zu empfinden. Ich kann jetzt auch die Groundhopper besser verstehen, die einfach guten und vielseitigen Fußball sehen möchten. Wenn das nicht so anstrengend wäre, könnte ich mich vielleicht sogar dafür begeistern.